Südeifel: Seriell ans kommunale Klimaziel
Wie eine schnelle, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung aussehen kann, zeigte eine Energiesprong on tour in die Südeifel. In der Gemeinde Körperich wird derzeit eine Turnhalle bei laufendem Schulbetrieb seriell saniert.

Mit der novellierten Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) hat die Europäische Union ihren Mitgliedsländern einen Sprint verordnet, der sportlich ist: Bis 2033 sollen 26 Prozent der energetisch schlechtesten Nichtwohngebäude auf Klimakurs gebracht werden. Das betrifft vor allem Schulen, Kitas und Turnhallen, die häufig in die Kategorie „Worst Performing Buildings“ fallen und das Klima sowie die kommunalen Haushalte überdurchschnittlich belasten. Wie eine schnelle, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung aussehen kann, zeigte eine Energiesprong on tour in die Südeifel. In der Gemeinde Körperich wird derzeit eine Turnhalle bei laufendem Schulbetrieb seriell saniert. Nach der Sanierung wird das Gebäude einen Energiesprung von der schlechtesten in die beste Effizienzklasse gemacht haben und damit energetisch auf Neubau-Niveau sein.
Mit gutem Beispiel vorangehen
Die 1971 erbaute Turnhalle der Grundschule St. Hubertus in Körperich zählt zu den 25 Prozent energetisch schlechtesten Gebäuden in Deutschland und hat somit einen besonders hohen Sanierungsdruck. Neben ihrer Funktion als Sportstätte für die Schülerinnen und Schüler sowie die Kinder der benachbarten KiTa hat sie auch eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung für die Gemeinde. Mitglieder unterschiedlichster Vereine haben hier die Möglichkeit, zu trainieren, zu proben, zu feiern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Damit die Turnhalle möglichst schnell wieder für sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten zur Verfügung steht, entschied sich die Verbandsgemeinde Südeifel für eine serielle Sanierung mit vorgefertigten Fassadenelementen und geht damit als erste Kommune in Rheinland-Pfalz mit gutem Beispiel voran. „Der Erhalt des Bestandsgebäudes und die Zeitersparnis haben uns überzeugt. Es gibt noch einige Sachen, wo es hakt. Aber es ist eben Neuland und wird sich mit jedem weiteren Projekt einspielen. Für uns ist die serielle Sanierung der richtige Weg und wir werden ihn in Zukunft weitergehen“, so das positive Fazit von Bürgermeisterin Anna Carina Krebs.
Mit sorgfältiger Bestandsanalyse auf Nummer sicher geben

Die neue Gebäudehülle wird aus heimischem Holz von einem regionalen Holzbauunternehmen im Werk gefertigt. Die Montage der 28 Fassadenelemente ist innerhalb von 10 Werktagen abgeschlossen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert regenerativen Strom für die Wärmepumpe, Warmwassererzeugung und Beleuchtung. Eine extensive Dachbegrünung verbessert den sommerlichen Wärmeschutz, dient als Wasserspeicher, absorbiert CO2 und fördert die Artenvielfalt.
Aus der zunächst angedachten Minimallösung des unbedingt Nötigen, die neben der seriellen Sanierung der Gebäudehülle auch die Modernisierung der Umkleideräume, Sanitäranlagen, Lüftung sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung und barrierefreie Erschließung vorsah, wurde nach einer umfassenden Bestandsanalyse eine Maximallösung des dringend Erforderlichen. Zusätzlich musste die Dachkonstruktion saniert sowie die Wärmeversorgung, der Hallenboden und Versorgungsleitungen erneuert werden. Das schloss die ursprünglich geplante Weiternutzung der Turnhalle während der seriellen Sanierung aus. Im Sommer 2026 wird die Halle kleinen und großen Sportlern wieder zur Verfügung stehen.
Mit Re-Use Ressourcen sparen
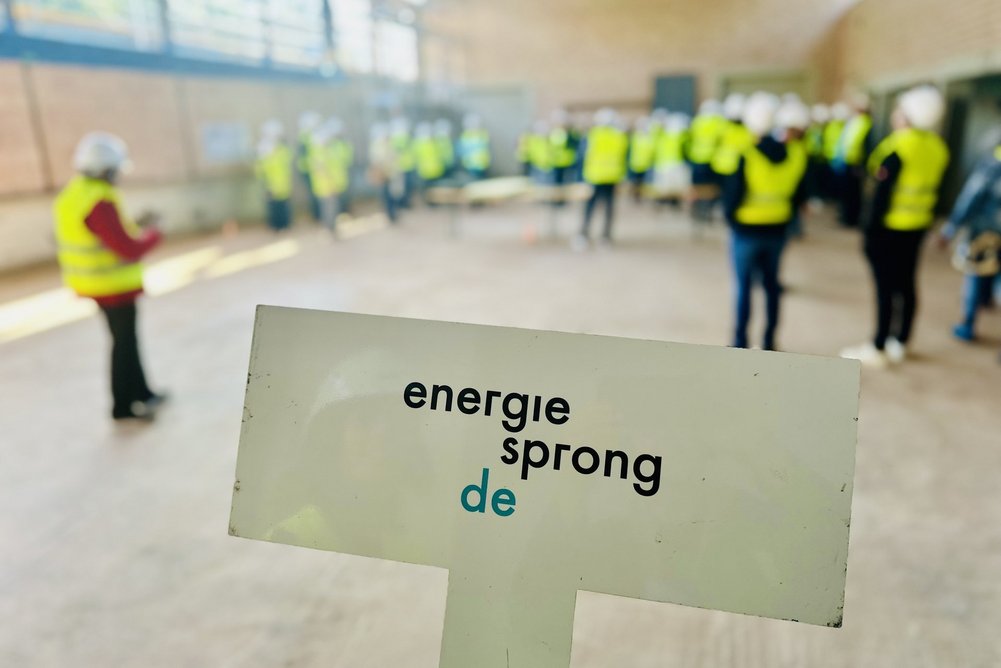
Kreislauffähigkeit ist beim seriellen Sanieren kein Muss, perspektivisch aber ein großes Plus. Denn nach zirkulären Prinzipien geplante Fassadenmodule können am Ende des Lebenszyklus als Materialdepot für neue serielle Sanierungsprojekte dienen – wenn die Weichen, wie beim Projekt in Körperich, bereits in der Planungsphase in Richtung Zirkularität gestellt werden. Die neue Holzfassade ist nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip konzipiert. Alle Baustoffe können am Ende des Lebenszyklus sortenrein zurückgebaut und wiederverwendet werden. „Uns war es außerdem wichtig, mit dem zu bauen, was da ist. Deshalb setzen wir möglichst viel Baumaterial des Bestandsgebäudes für die serielle Sanierung ein“, erklärt Architektin Sabine Reiser. So fungiert die Stehfalzeindeckung des Daches künftig als Verkleidung des Umkleidetraktes. Das Holz des zurückgebauten Satteldaches wird als Unterkonstruktion für die Fassadenmodule eingesetzt. Neben der im Bestandsgebäude gespeicherten „grauen Energie“ werden durch die Weiterverwendung der Materialien Rohstoffe, Energie und CO2 eingespart. Das ist nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, sondern rechnet sich angesichts immer knapper werdender natürlicher Ressourcen und explodierender Rohstoffpreise auch wirtschaftlich.
Mit maßgeschneidertem Fördermix mehr erreichen

Das Sanierungsprojekt in Körperich zeigt zudem, wie Kommunen ihren Gebäudebestand durch eine kluge Kombination von Bundes- und Landesfördermitteln kostenoptimiert modernisieren können. Ein Mix aus sechs unterschiedlichen Förderprogrammen sorgte unterm Strich dafür, dass die Verbandsgemeinde Südeifel nur rund ein Viertel der sich auf 2,37 Mio. Euro belaufenden Sanierungskosten selbst tragen muss. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Projekt mit 500.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) und 100.000 Euro aus dem Klimabündnis Bauen RLP (Schwerpunktregion Holzbau Trier). „In Körperich sehen wir, dass die Fördermittel gut angelegtes Geld sind. Einerseits, weil sich der regionale Holzbau und serielles Sanieren wunderbar ergänzen. Anderseits, weil die Förderung auch finanzschwachen Kommunen die Chance eröffnet, ihre Liegenschaften auf Klimakurs zu bringen“, betont Staatssekretär Michael Hauer. Erste Anlaufstelle zur seriellen Sanierung im Allgemeinen und zur Förderung im Speziellen ist die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Sie navigiert Kommunen sicher durch den Förderdschungel. Die Unterstützung reicht von der Auswahl passender Förderprogramme über die Prüfung etwaiger Kumulierungsmöglichkeiten bis zur Beantragung.
Mit Machbarkeitsstudien Vergabehürden meistern
Eine der größten Hürden für kommunale Bestandshaltende stellt das öffentliche Vergaberecht dar, das bei der seriellen Sanierung an seine Grenzen stößt. Die bisherige Vergabepraxis geht von einem traditionellen arbeitsteiligen Prinzip aus, bei dem ein Gewerk auf das nächste folgt. Beim seriellen Sanieren hingegen laufen viele Prozesse parallel und erfordern eine gewerkeübergreifende Zusammenarbeit. Und diese Besonderheit kollidiert mit den klassischen Vergaberegelungen. Doch das Leistungsbestimmungsrecht eröffnet öffentlichen Auftraggebern eine Hintertür: Liegen objektiv nachvollziehbare auftrags- und sachbezogene Gründe vor, dürfen mehrere Teil- oder Fachlose zusammen vergeben werden. Allerdings nur dann, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. „Lassen Sie sich im Vorfeld eines seriellen Sanierungsvorhabens eine Machbarkeitsstudie erstellen“, rät Hannsjörg Pohlmeyer, Leiter des Holzbauclusters Rheinland-Pfalz. „Sie liefert Ihnen wirtschaftlich und technisch fundierte Argumente für die rechtssichere Zusammenfassung von Einzellosen.“
Die serielle Turnhallensanierung in Körperich bietet ökologische, ökonomische und technische Lösungen für die Sanierung baugleicher Turnhallen in ganz Deutschland und kann damit zur Blaupause über die Grenzen Rheinland-Pfalz hinaus werden. Interessierte Kommunen sind herzlich eingeladen, sich das Projekt vor Ort anzuschauen.
